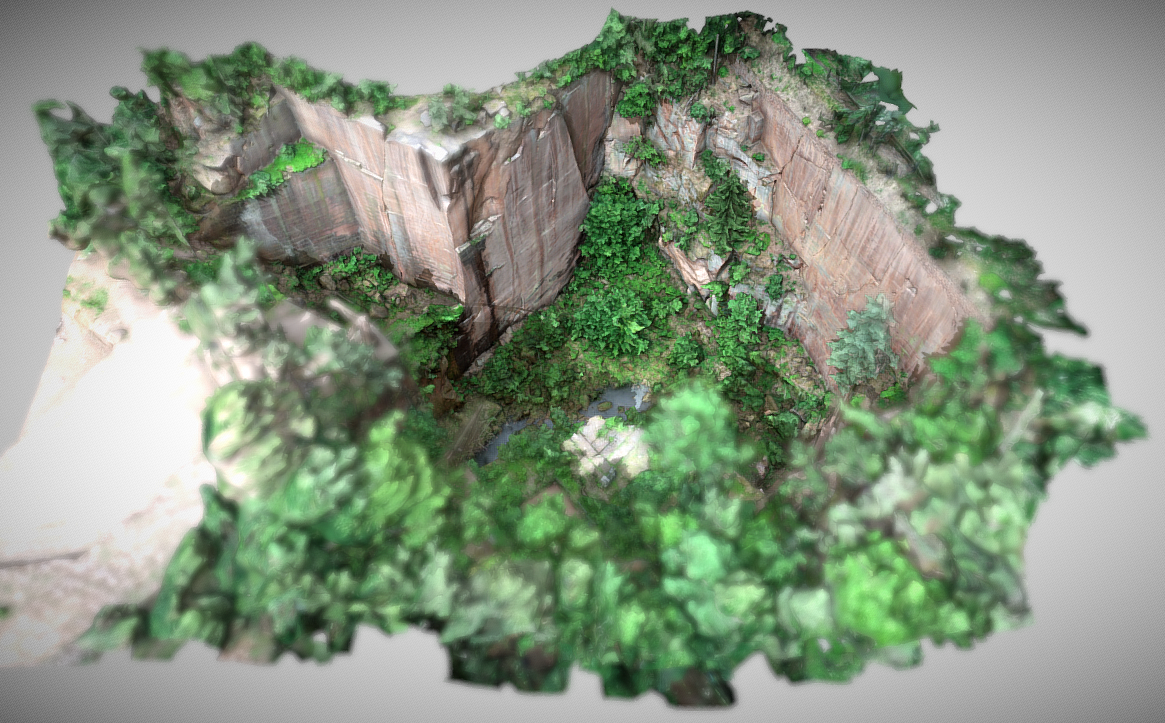Rochlitzer Porphyrtuff ist erster „IUGS Heritage Stone“ Deutschlands
Die International Union of Geological Sciences (IUGS, https://www.iugs.org/) ist die Dachorganisation aller Geologen weltweit. Sie verleiht auch den Titel „IUGS Heritage Stone“ für Bausteine/Natursteine, die in bedeutenden Bauwerken und Denkmälern verwendet wurden und damit ein integraler Bestandteil der menschlichen Kulturgeschichte auf internationaler Ebene sind. Im Herbst 2022 wurde der Rochlitzer Porphyrtuff als erstes deutsches Gestein in einer Reihe von bisher 32 Nominierungen mit dieser Auszeichnung gekrönt.
Die Urkunde dazu wurde am 30.05.2023 im Rochlitzer Rathaus vom Initiator für diese Auszeichnung, Prof. Heiner Siedel von der Technischen Universität Dresden-Institut für Geotechnik- Fachbereich Angewandte Geologie im Beisein von Vertretern der Region Rochlitz und des Nationalen Geoparks Porphyrland überreicht.
Rochlitzer Porphyrtuff auf der Website der Kulturerbesteine (Link)
Einen Fachartikel zum Rochlitzer Porphyrtuff als erster deutscher Kulturerbestein „Heritage Stone“ finden Sie HIER

Gleisbergbruch auf dem Rochlitzer Berg
Foto: Bastian Rakow
3D-Visualisierung des Gleisbergbruchs
Prof. Dr. Heiner Siedel übergibt die Urkunde „IUGS Heritage Stone“ an den Oberbürgermeister der Stadt Rochlitz, Frank Dehne
Schloss Rochlitz
Foto: Martin Rust
Pöppelmannbrücke in Grimma (Foto: Frank Schmidt)
Propsteikirche St. Trinitatis in Leipzig
Foto: Bernhard Weiß